Anatomie

Anatomie
Menschlicher Körper Zeichnung: Tipps & Techniken für Anfänger

Anatomie
Hospitation im Krankenhaus: Tipps für den perfekten Einstieg

Anatomie
MRT Knie Bilder auswerten: Der Expertenleitfaden für Mediziner
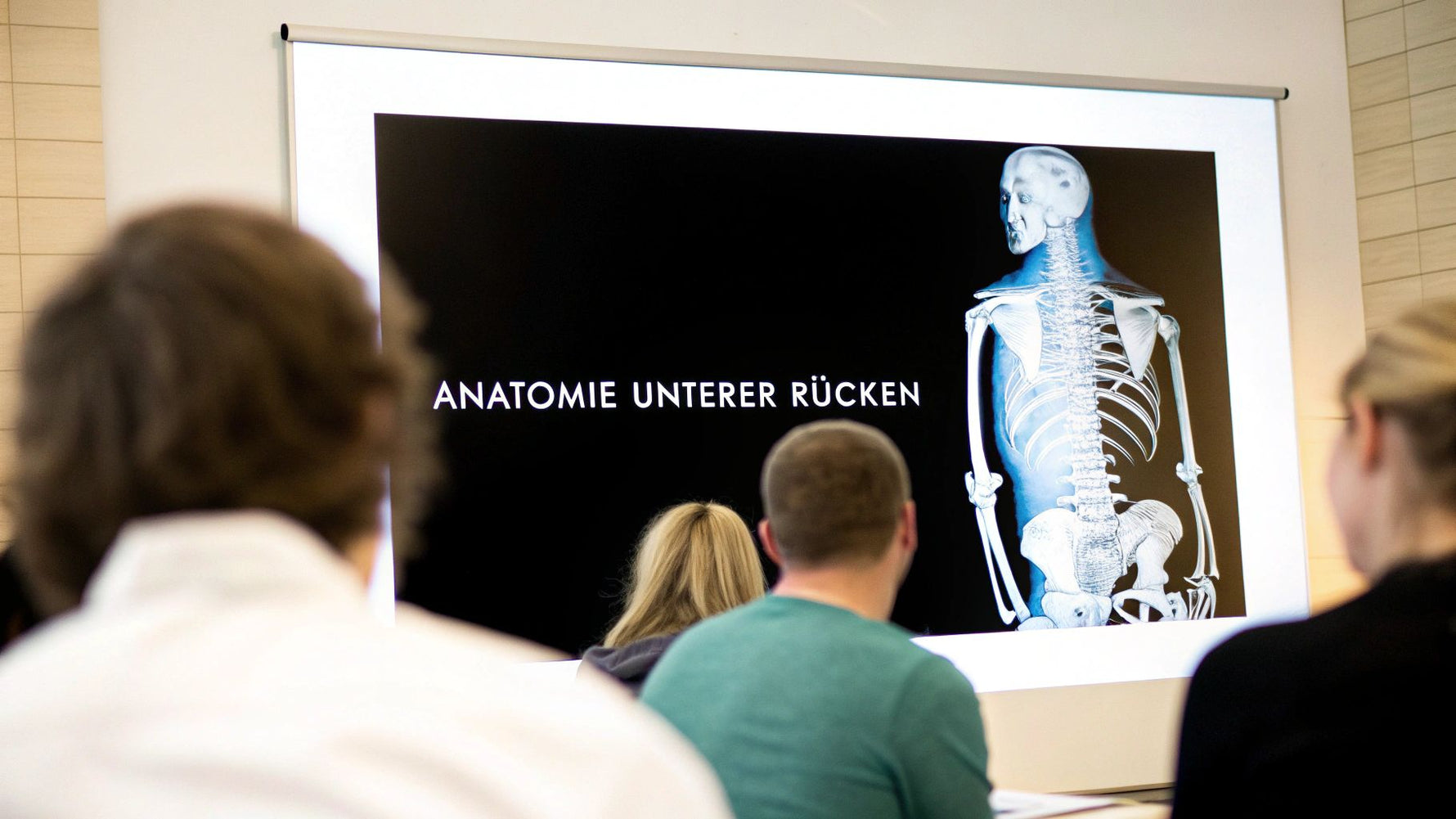
Anatomie
Anatomie unterer Rücken: Aufbau & Funktionen verstehen
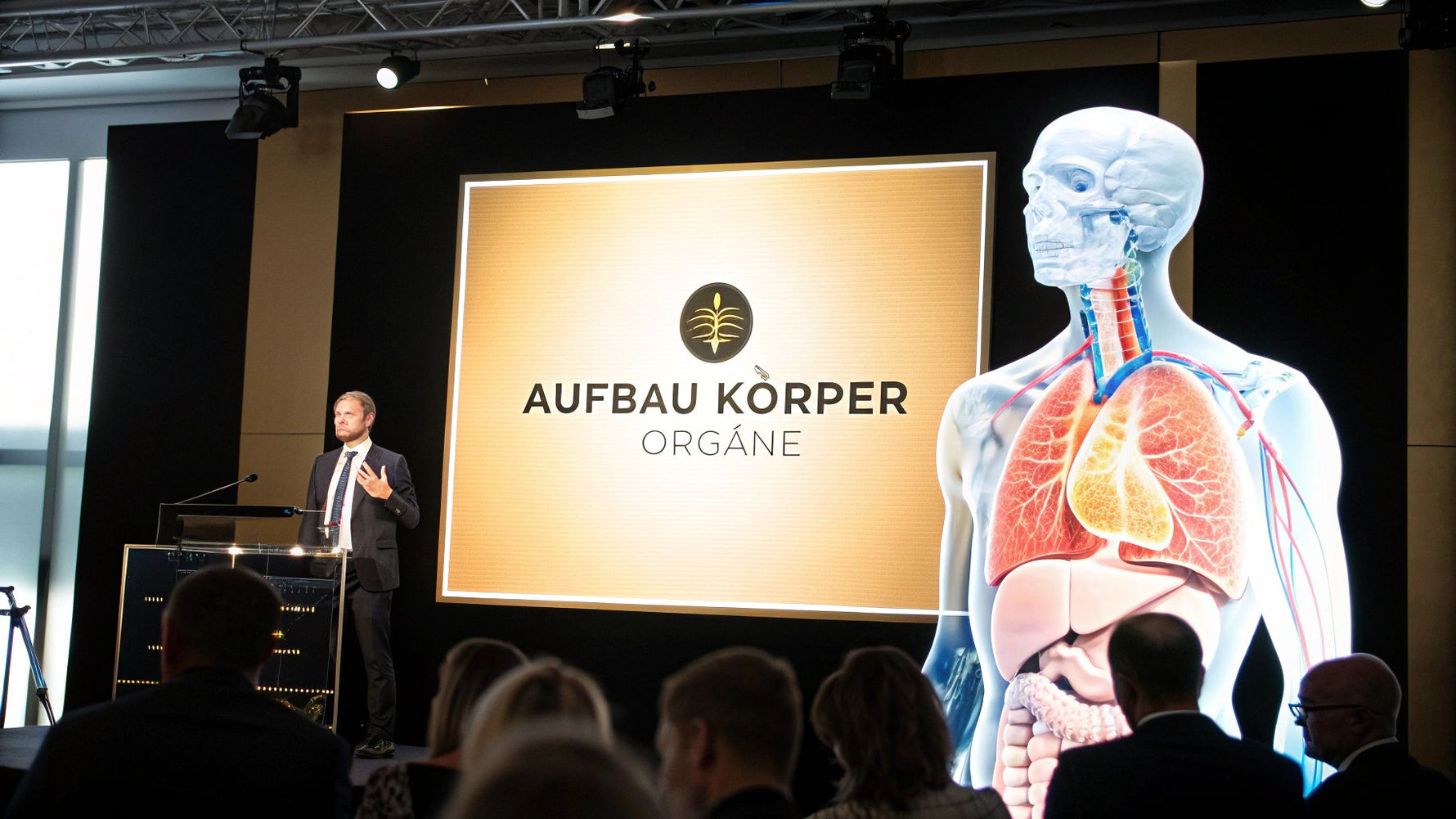
Anatomie
Aufbau Körper Organe: Wichtige Fakten und Funktionen
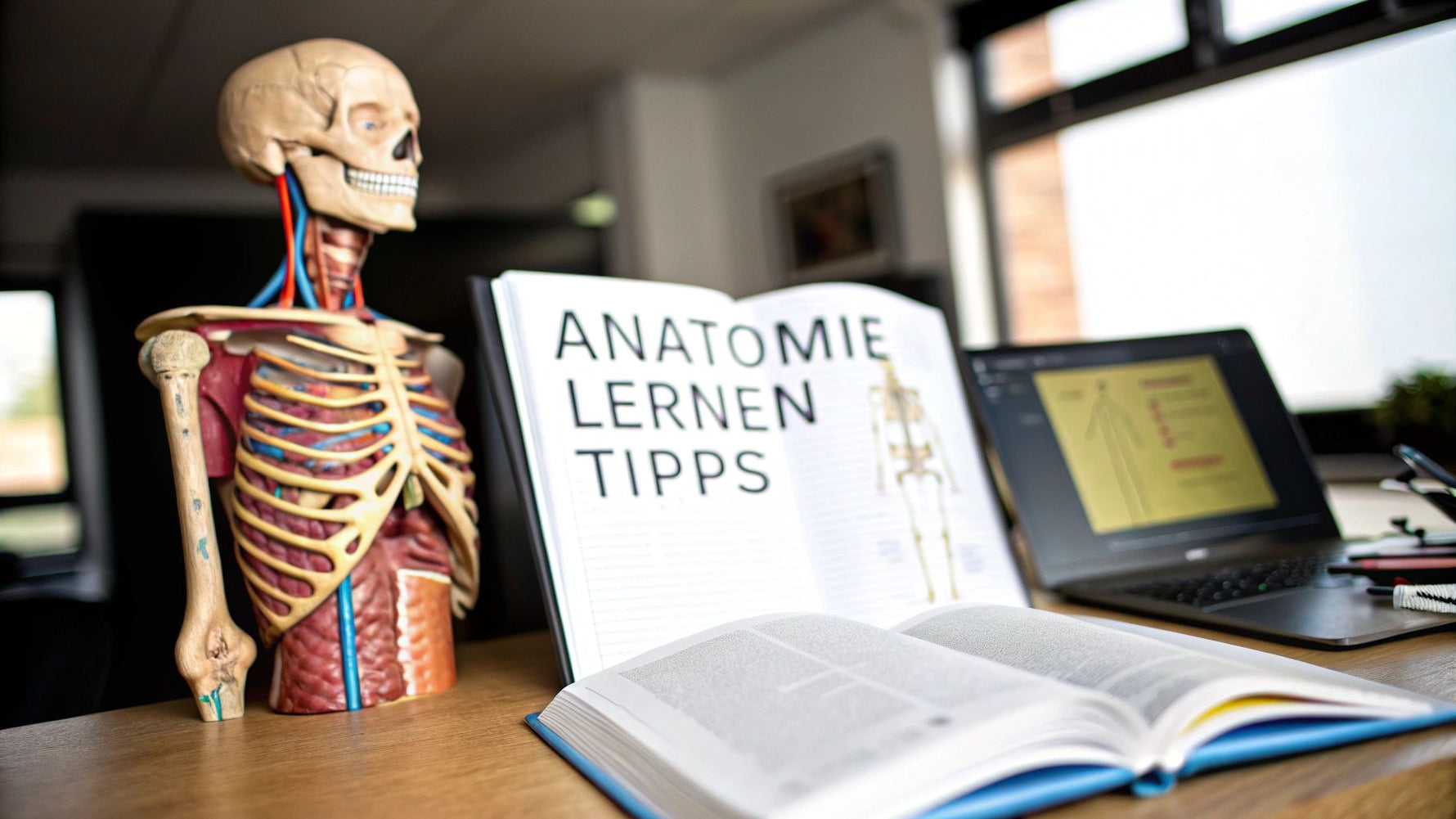
Anatomie
Anatomie lernen Tipps: So gelingt dir das Lernen leicht
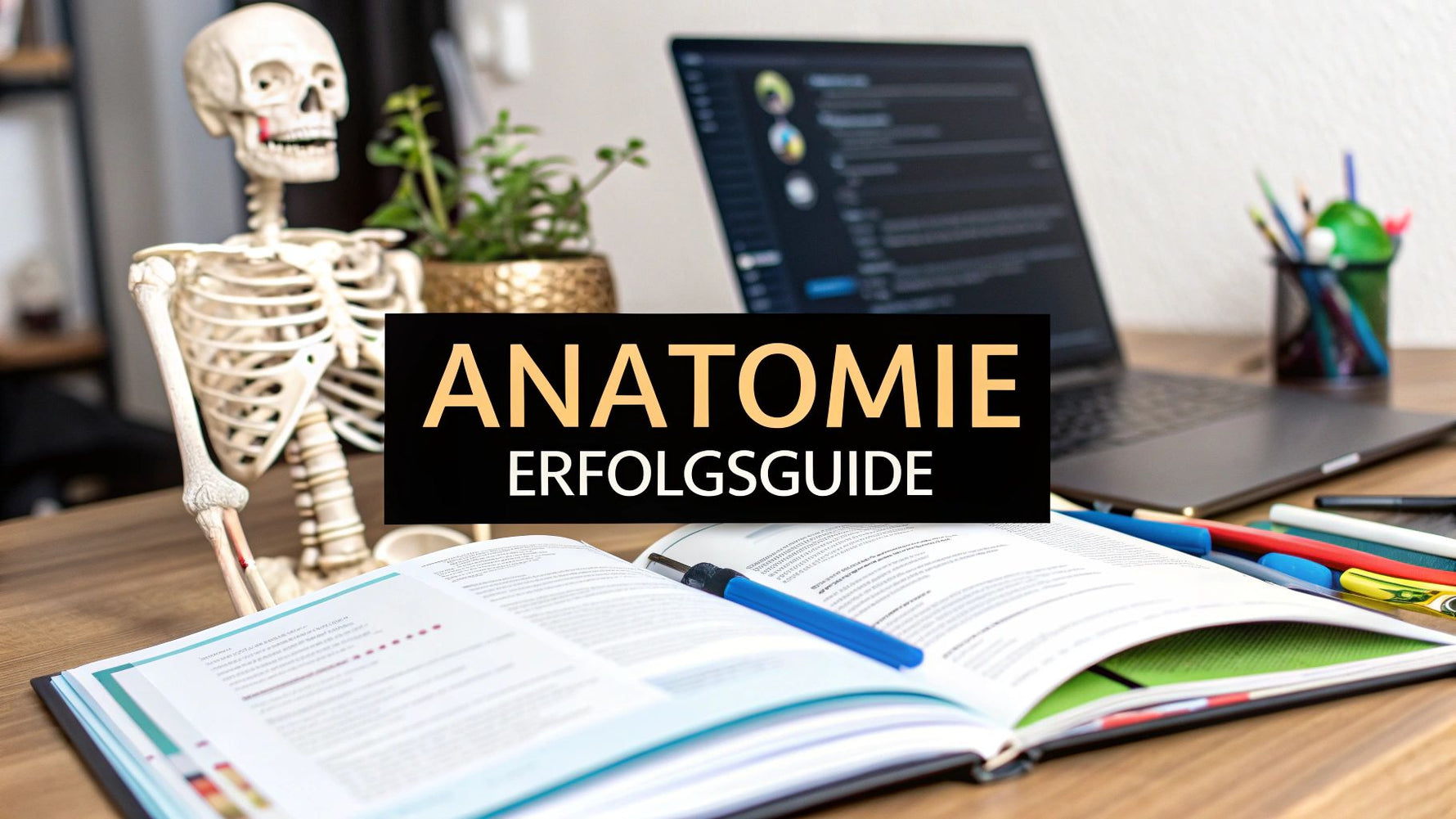
Anatomie
Anatomie Lernen: Der Erfolgsguide in wenigen Schritten

Anatomie
Physiologie für Mediziner: Schlüsselwissen für Ihren Erfolg

Anatomie
Skelett Mensch Knochen: 8 Interessante Fakten im Überblick
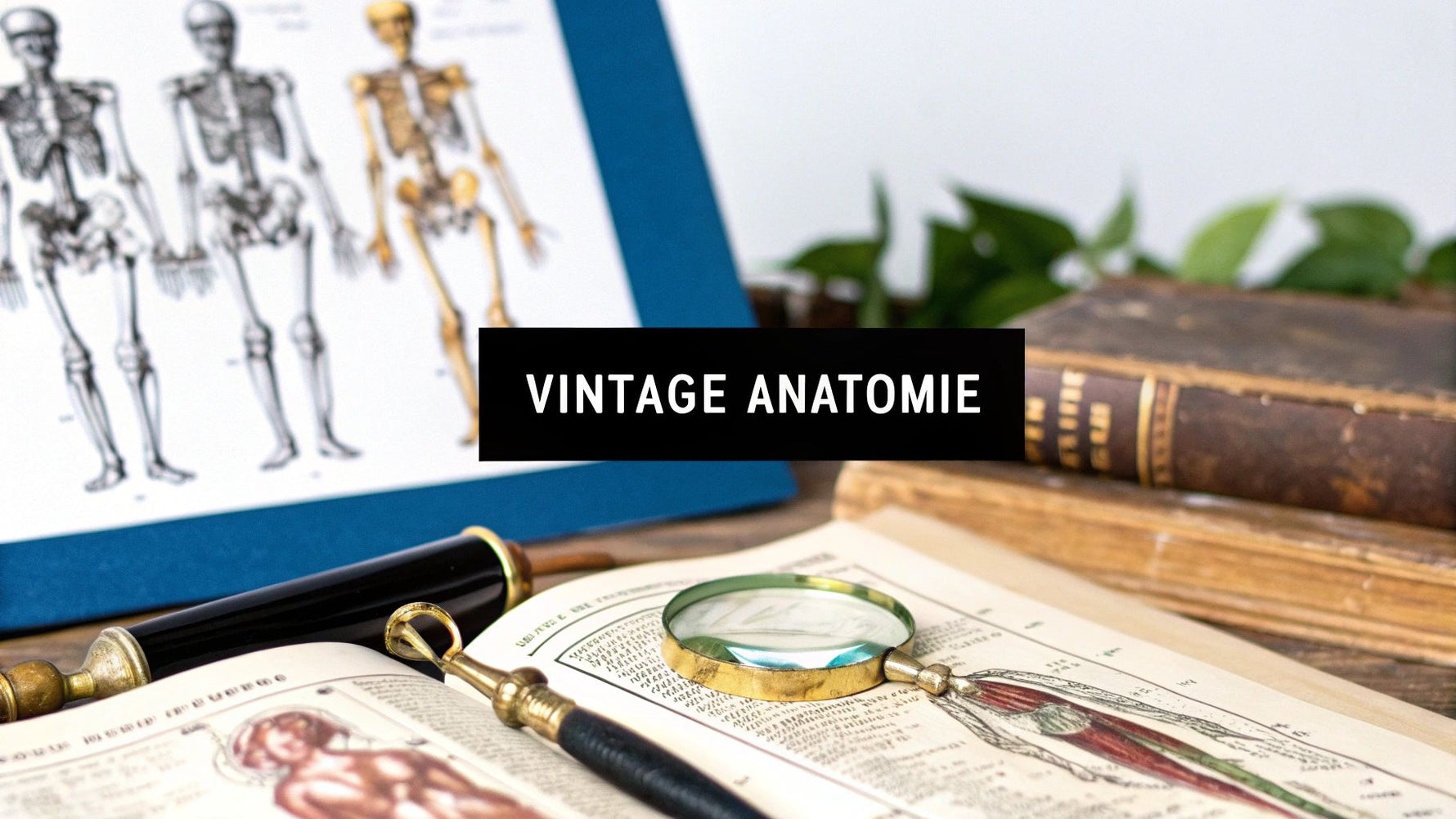
Anatomie
7 Anatomie Poster Vintage – Faszinierende Vintage Anatomie Poster

Anatomie
Anatomie des Körpers Organe: Die 10 wichtigsten im Überblick
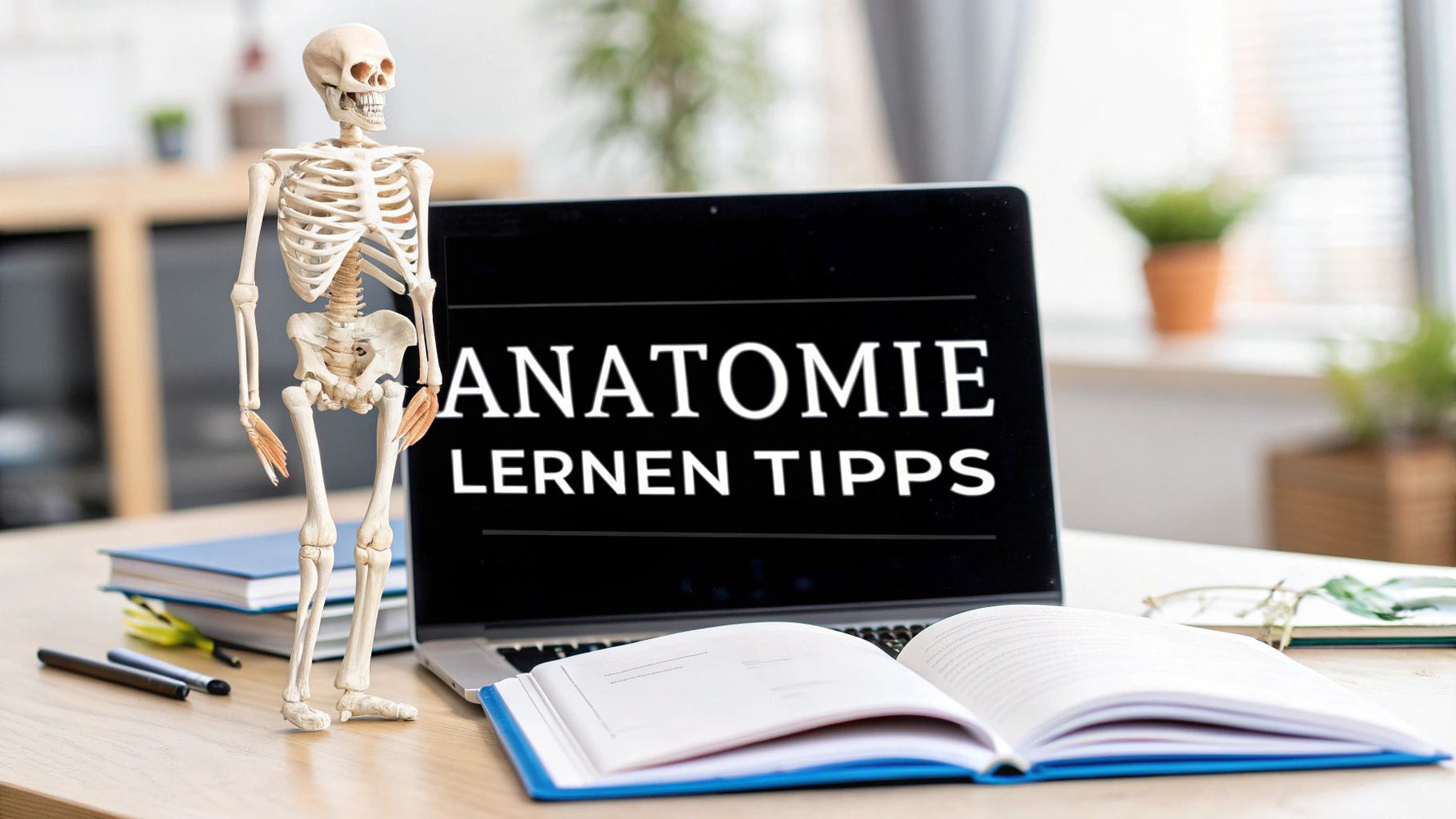
Anatomie
Anatomie Lernen Tipps: Erfolgreich Anatomie meistern
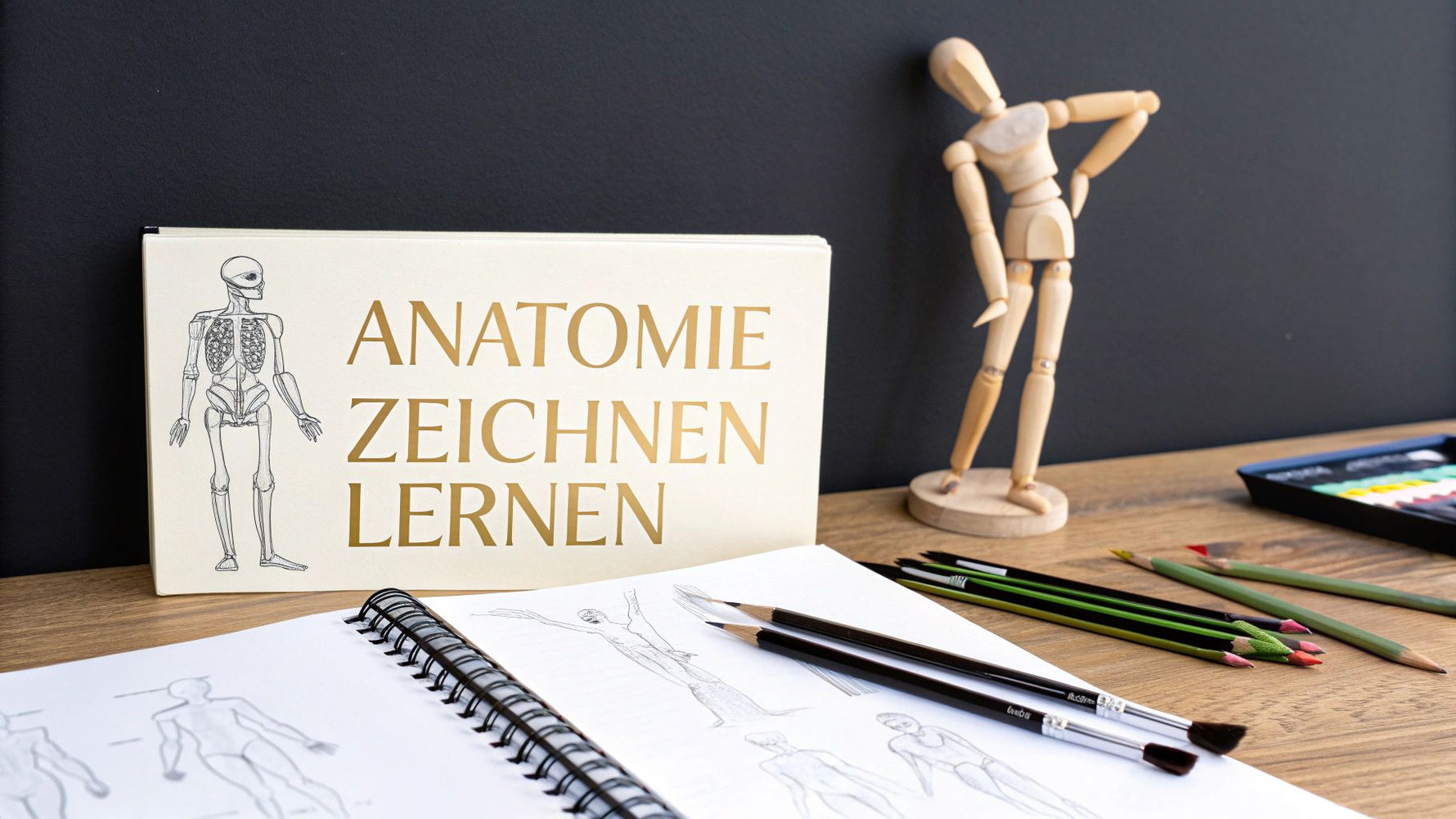
Anatomie
Anatomie zeichnen lernen: Tipps & Übungen für Anfänger

Anatomie
Poster Handball: Kreative Designideen für 2025
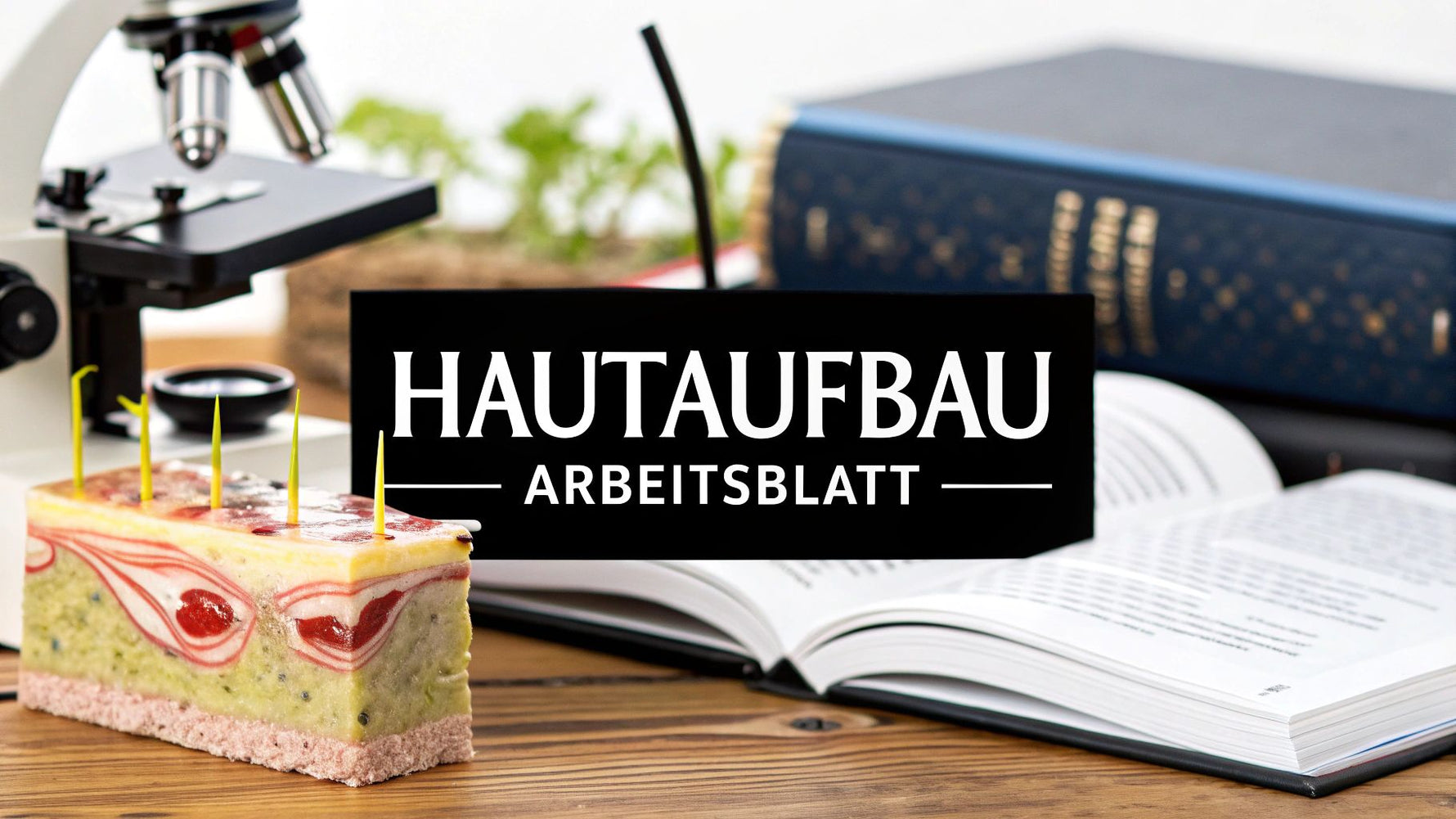
Anatomie
Aufbau der Haut Arbeitsblatt – Effektives Unterrichtsmaterial

Anatomie
Entdecke organe des menschen arbeitsblatt interaktiv
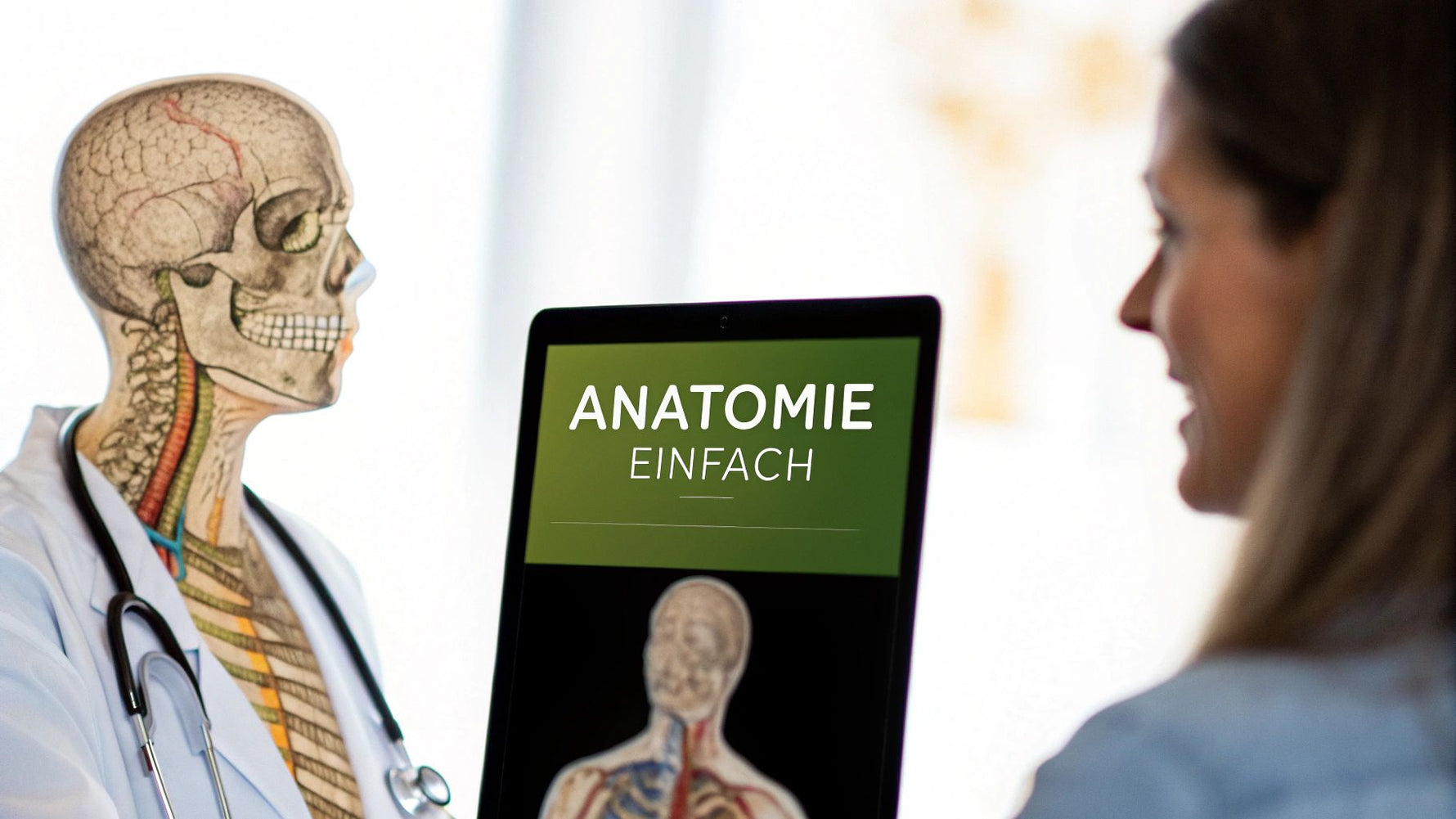
Anatomie
Anatomie einfach erklärt: Dein Körper im Überblick

Anatomie
Delegation in der Pflege: Effiziente Arbeitsstrategien

Anatomie
Wandbilder Arztpraxis: Kreativ & Modern

Anatomie
uni ranking medizin deutschland: Top 2025 Choices